Auf eine Darstellung der vielfältigen und hitzigen Diskussion zu den Ursachen von Autismus verzichten wir hier ganz bewusst. Denn keiner der Ansätze erklärt überzeugend alle Phänomene der Störung. Für die vorliegende Arbeit setzen wir die diagnostizierte autistische Störung als gegeben voraus. Als gesichert anzunehmen ist, dass eine genetische Komponente ein notwendiger, jedoch nicht hinreichender Auslöser ist. Des Weiteren konnte durch bildgebende Verfahren nachgewiesen werden, dass Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung viele Wahrnehmungen an anderen Stellen im Gehirn verarbeiten als sonst. Einen Überblick über den Bereich der autistischen Störungen gibt F. Poustka 2004.
1.1 Zur Geschichte der autistischen Entwicklungsstörung
Der Begriff „autistisch“ wurde erstmals von Bleuler (1911) eingeführt, um einseitig auf sich bezogenes Denken schizophrener Patienten zu beschreiben. Dies dokumentiert jedoch nicht das erste Auftreten von autistischen Verhaltensweisen, wie frühere medizinische Aufzeichnungen (für einen Überblick siehe Frith, 1992) belegen.
Unabhängig voneinander beschrieben dann Kanner (1943) und Asperger (1944) Kinder mit ähnlichen Verhaltensweisen. Kanner (1943) bezeichnet das Krankheitsbild als „Frühkindlichen Autismus“ und ordnet die Verhaltensstörung den Kindheitspsychosen zu. Er grenzt Autismus aufgrund seines frühen Beginns deutlich von der Kindheitsschizophrenie ab.
Die Kardinalsymptome des „Frühkindlichen Autismus“ sind seiner Meinung nach in der extremen Selbstbezogenheit bzw. der Unfähigkeit zur antizipatorischen Kontaktaufnahme der Betroffenen und dem Bedürfnis zur zwanghaften Gleicherhaltung der Umwelt mit den daraus resultierenden Veränderungsängsten zu sehen.
Des Weiteren treten Sekundärsymptome wie zum Beispiel der auffällige Umgang mit Objekten, und, bei sprechenden Kindern mit Autismus, Sprachauffälligkeiten (zum Beispiel Echolalie, Pronominalumkehr sowie der fehlende Einsatz von Sprache als Kommunikationsmittel) auf. Aufgrund der festgestellten Intelligenz- und Gedächtnisleistungen der untersuchten Kinder differenziert Kanner den „Frühkindlichen Autismus“ von einer geistigen Behinderung.
Nach breiter Diskussion der Fachwelt über Diagnosekriterien und Nomenklatur der beschriebenen Verhaltensweisen (für einen Überblick siehe Lösche, 1992) veröffentlichte Rutter (1978) eine viel beachtete Definition, die Kanners Kardinalsymptome aufgreift und den Begriff der „Kindheitspsychose“ (Kanner, 1943) durch den der „Entwicklungsstörung“ (Rutter, 1978) ersetzt.
Im Gegensatz zu Kanner spricht Asperger (1944) von „Autistischen Psychopathen“. Er beschreibt ähnliche Verhaltensauffälligkeiten wie Kanner, die er allerdings nur bei Jungen findet und, aufgrund der gezeigten intellektuellen Fähigkeiten, als „Extremvariante des männlichen Charakters“ (Asperger, 1944, S. 129) bezeichnet. Insgesamt entsteht der Eindruck, dass Asperger eher die sprechende und intelligentere Gruppe der Menschen mit Autismus beschreibt, während Kanner auch die mit geistiger Behinderung einbezogen hat (Bormann – Kischel, 1984, zitiert nach Riehemann, 1992, S. 5).
Trotz der intensiven Auseinandersetzung mit dem Thema hat sich bis heute kein einheitlicher Terminus für das Symptombild Autismus durchsetzen können. So differenzierte Kehrer (1989) als einer der ersten deutschsprachigen Wissenschaftler zum Autismus in autistische Züge, autistische Verhaltensweisen und Autismus-Syndrom. Diese Unterteilung verwendete die von ihm geleitete Diagnose-Ambulanz des Institutes für Autismusforschung in Münster für ihre Diagnosen.
Selbst die beiden am häufigsten benutzten Klassifikationsmanuale psychischer Störungen unterscheiden sich in ihrer Benennung einerseits als „Autistische Störung“ (codiert mit 299.00) im DSM-IV (Saß, Wittchen & Zausig, 1996) und andererseits als „Frühkindlicher Autismus“ (verschlüsselt mit F 84.0) in der „Internationalen Klassifikation psychischer Störungen“ (ICD-10) (Dillinger, Mombour & Schmidt, 2005). Zusätzlich differenziert letzteres noch „atypischen Autismus“ (F 84.1) und das „Asperger-Syndrom“ (F 84.5), während ersteres noch die „Asperger-Störung“ (299.80) und unter der gleichen Ziffer die „nicht näher bezeichnete tiefgreifende Entwicklungsstörung (einschließlich Atypischer Autismus)“ (299.80) abgrenzt.
Aktuell wird zunehmend der Begriff Autismus-Spektrum-Störung verwendet, um dem breit gestreuten Erscheinungsbild gerecht zu werden, das zudem eine klare Abgrenzung der verschiedenen Unterformen nicht immer klar vornehmen lässt.
1.2 Klassifikation und Symptomatik
Sowohl das DSM-IV als auch die ICD-10 ordnen Autismus als tiefgreifende Entwicklungsstörung ein. In der Autismus-Forschung hat sich inzwischen folgende Definition durchgesetzt: Autismus ist eine Störung, die durch „eine deutlich abnorme und beeinträchtigte Entwicklung im Bereich der sozialen Interaktion und der Kommunikation sowie durch ein deutlich eingeschränktes Repertoire an Aktivitäten und Interessen“ gekennzeichnet ist (DSM-IV, Saß, Wittchen & Zausig, 1996, S. 103).
Abnorm heißt dabei, dass das beobachtete Verhalten weder seinem (verzögerten) Entwicklungsstand, noch seinem chronologischen Alter angemessen ist. Das DSM-IV beruht also im Grunde auf den von Kanner 1943 als Kardinalsymptome frühkindlichen Autismus beschriebenen Verhaltensweisen. Die medizinische Diagnose in Deutschland erfolgt allerdings häufig nach dem ICD-10, das in den Diagnose-Kriterien mit dem DSM-IV übereinstimmt. In beiden Fällen handelt es sich um eine Sammlung von Verhaltensweisen, die Autismus als Störung charakterisieren und dessen Diagnose über Symptomlisten zu erfolgen hat.
In der multiaxialen Beurteilung des DSM-IV werden die tiefgreifenden Entwicklungsstörungen auf der Achse I „Klinische Störungen, Andere Klinisch Relevante Probleme“ codiert und gelten im Falle einer Mehrfachdiagnose als Hauptdiagnose. Auf der Achse II wird neben den Persönlichkeitsstörungen die geistige Behinderung codiert.
Das ICD-10 listet drei Hauptbereiche auf, in denen Manifestationen der Autismus-Spektrum-Störungen auftreten müssen: insgesamt mindestens sechs, davon mindestens zwei aus (1) und jeweils eine aus (2) und (3). Der Beginn der Störung liegt vor dem dritten Lebensjahr. Dabei werden Auffälligkeiten in der sozialen Interaktion, in der Funktion der Sprache als Kommunikationsmittel und/oder im Bereich der Verhaltensweisen, Interessen, und Aktivitäten gezeigt.
Im Einzelnen handelt es sich dabei um:
1. Qualitative Beeinträchtigung der sozialen Interaktion
- ausgeprägte Beeinträchtigung beim Gebrauch vielfältiger nonverbaler Verhaltensweisen wie beispielsweise Blickkontakt, Gesichtsausdruck, Körperhaltung und Gestik zur Steuerung sozialer Interaktion
- Unfähigkeit, entwicklungsgemäße Beziehungen zu Gleichaltrigen aufzubauen
- Mangel, spontan Freude, Interessen oder Erfolg mit anderen zu teilen
- Mangel an sozio-emotionaler Gegenseitigkeit
2. Qualitative Beeinträchtigung der Kommunikation
- verzögertes Einsetzen oder völliges Ausbleiben der Entwicklung von gesprochener Sprache und kein Versuch, dies zu kompensieren
- bei Personen mit ausreichendem Sprachvermögen deutliche Beeinträchtigung der Fähigkeit, ein Gespräch zu beginnen oder fortzuführen
- stereotype oder repetitiver Gebrauch der Sprache oder idiosynkratische Sprache
- Fehlen von verschiedenen entwicklungsgemäßen Rollenspielen oder sozialen Imitationsspielen
3. Deutlich eingeschränktes Repertoire von Aktivitäten und Interessen
- umfassende Beschäftigung mit einem oder mehreren stereotypen und begrenzten Interessen, wobei Inhalt und Intensität abnorm sind
- auffällig starres Festhalten an bestimmten nicht-funktionellen Gewohnheiten oder Ritualen
- stereotype und repetitive motorische Manierismen
- ständige Beschäftigung mit Teilen von Objekten
Diese Merkmalsliste gibt die Forschungsergebnisse zur Symptomatik der Autismus-Spektrum-Störungen zusammenfassend wieder. Eine ausführlichere Darstellung der Forschung findet sich bei Kehrer (1989), Innerhofer & Klicpera (1988) oder auch bei Büttner (1995).
Einige Autoren, wie zum Beispiel der Bundesverband „autismus“ (1996), sehen, in Erweiterung des DSM-IV, Wahrnehmungsverarbeitungsstörungen als ein weiteres kennzeichnendes Merkmal für Menschen mit Autismus an (vgl. auch Cordes & Dzikowski, 1991; Innerhofe r& Klicpera, 1988; Kehrer, 1989; Ritvo & Freeman, 1978; Rollett & Kastner – Koller, 1994). Der Bundesverband gibt hier die heute in der therapeutischen Praxis bei Autismus-Spektrum-Störungen stark vertretene Behandlung von Wahrnehmungsverarbeitungsstörungen wieder.
Weitere mögliche Auffälligkeiten können beim Ess- und Schlafverhalten, bei der Stimmung oder dem Affekt auftreten oder sich in Form von fremd- oder autoaggressivem Verhalten, Hyperaktivität, kurzer Aufmerksamkeitsspanne oder Impulsivität darstellen. Die störungsbeschreibenden Sprach- und Sprechauffälligkeiten, zum Beispiel bei den Kriterien der produktiven Prosodie wie Tonhöhe, Sprechrhythmus, Geschwindigkeit oder Intonation (siehe Grimm & Engelkamp, 1981), treten nur bei ungefähr 60 Prozent der Betroffenen auf. Mindestens 40 Prozent sprechen überhaupt nicht.
Häufig wird von einem ängstlichen Verhalten, zum Teil sogar bei harmlosen Dingen, berichtet. Dass Angst ein bestimmendes Element des Alltags ist, wird in den Lebensberichten von Menschen mit Autismus bestätigt (Grandin, 1992, 1994; Zöller, 1992).
Überdurchschnittlich häufig tritt eine Mehrfach-Behinderung von Autismus und geistiger Behinderung (bei über 70 Prozent) auf (Gillberg, 1988), wie sie schon von Kanner (1943) beschrieben wird. Dabei ist das Fähigkeitenprofil in standardisierten Intelligenztests nicht einheitlich. Mit anderen Worten: Man kann nicht davon ausgehen, dass die gemessenen Fähigkeiten sich wie im Regelfall ungefähr auf einem Niveau bewegen, sondern einzelne Bereiche mit deutlichen Leistungsspitzen oder Defiziten vom individuellen Gesamtprofil abweichen.
Neben diesen Defiziten werden immer wieder überdurchschnittliche Teilleistungen oder Fähigkeiten von Menschen mit Autismus beschrieben (für einen Überblick siehe Kehrer, 1989, 1992). Auch überdurchschnittliche Rechen-, Schreib- und Lesefähigkeiten treten auf, teilweise ohne dass die Menschen mit Autismus den Inhalt dessen, was sie lesen oder schreiben, verstehen. Außerdem werden immer wieder herausragende Gedächtnisleistungen in den verschiedensten Bereichen erwähnt (zum Beispiel Kalender-gedächtnis, Zahlen-Gedächtnis, geographisches und visuelles Gedächtnis).
Charakteristisch für Autismus-Spektrum-Störungen ist das sehr inhomogene und variationsreiche Störungsbild sowie zusätzlich dessen schwankender und individueller Ausprägungsgrad.
1.3. Differentialdiagnostik
Die beiden Klassifikationssysteme psychischer Störungen verwenden weitgehend übereinstimmende Beschreibung der autistischen Störungen.
Das „Asperger-Syndrom (F84.5)“ (ICD-10, 2005) zeichnet sich durch die gleichen qualitativen Störungen wie der „Frühkindliche Autismus (F84.0)“ (ICD-10, 2005) aus. Betroffene zeigen im Gegensatz zu dieser keine kognitive und sprachliche Entwicklungsverzögerung. Dass es sich zum einen bei dieser Differenzierung um unterschiedliche Störungen oder zum anderen um „möglicherweise unterschiedliche Erscheinungsformen im Spektrum eines psychischen Grundleidens“ handelt (Jørgensen, 1998, S. 82) bzw. die Asperger-Störung „nur ... eine leichtere Form des Kanner-Syndroms“ darstellt (Hebborn – Brass, 1993, S. 23), zeigt die widersprüchliche fachliche Diskussion (s.a. Kehrer, 1989).
In Fällen, in denen nicht in allen drei Bereichen die geforderten Diagnose-Kriterien der Störung erfüllt sind bzw. erst nach dem dritten Lebensjahr auftreten, sich aber ansonsten ein sehr ähnliches Bild zeigt, wird „atypischer Autismus (F 84.1)“ nach dem ICD-10 (2005) diagnostiziert.
Zudem muss seit einigen Jahren auch eine Abgrenzung zur „Rett-Störung“ (299.80 im DSM-IV, 1996; F 84.2 im ICD-10, 1993) vorgenommen werden. Häufig wurde die bisher ausschließlich bei Mädchen gefundene Rett-Störung anfangs aufgrund eines ähnlichen Symptombildes fälschlicherweise mit Autismus diagnostiziert. Eine Abgrenzung erfolgt neben dem unterschiedlichen Verlauf und dem Stillstand des Kopfwachstums bei der Rett-Störung insbesondere über die Motorik. Das heißt im Gegensatz zur Autismus-Spektrum-Störung verlieren Mädchen mit Rett-Störung nach anfänglich normaler Entwicklung die bewusste zielgerichtete Bewegungskontrolle (s.a. Rutter, 1988).
Die Abgrenzung zur „Desintegrativen Störung“ im Kindesalter erfolgt wiederum über eine normale Entwicklung bis zum zweiten Lebensjahr, vor allem im sozial-kommunikativen Bereich mit anschließender Entwicklungsregression.
Stereotypes Verhalten, auch im sprachlichen Bereich, kann als „Wahn“ gedeutet werden. Aufgrund der fehlenden Halluzinationen und des frühen Beginns bei Autismus muss allerdings von einer „Schizophrenie-Diagnose“ abgesehen werden (DSM-IV, 1996). Eine Abgrenzung zur Zwangsstörung erfolgt meist über die ich-synthone Zuschreibung bzw. die als sinnvoll erlebte Durchführung der Rituale.
Bei „Aphasien“ kann es durch den Sprachverlust zu sozialem Rückzugsverhalten kommen, das allerdings nicht der qualitativen Beeinträchtigung bei Autismus entspricht, da außerdem die nonverbale Kommunikation kaum auffällig ist (Weber, 1988).
Diverse Untersuchungen konnten nachweisen, dass zwar ein Teil der betroffenen Menschen mit Autismus eine mehr oder weniger starke „geistige Behinderung“ aufweist, es sich aber um zwei verschiedene Behinderungsformen handelt, da sich das autistische Störungsbild unabhängig von der intellektuellen Beeinträchtigung gleich darstellt. Menschen mit geistiger Behinderung sind zudem selbst bei schwerem Ausprägungsgrad im Gegensatz zu Menschen mit Autismus noch an sozialen Kontakten interessiert und kommunikationsfähig (vgl. Kusch & Petermann, 2001). Letzteres gilt auch für die Abgrenzung von „Sprachstörungen“ sowie „Elektivem Mutismus“.
Generell gilt, dass neben der autistischen Beeinträchtigung komorbid weitere Beeinträchtigungen auftreten können, wie zum Beispiel Zwänge, Hyperaktivität, ADHS und/oder affektive Störungen wie Ängste und Depression.
1.4 Epidemiologie
Die Prävalenzrate für frühkindlichen Autismus beträgt je nach Untersuchung 16,8 von 10.000 Personen und 8,4 von 10.000 Personen für Asperger (Poustka, 2004 S. 18). Die Störung tritt bei Jungen vier bis fünf Mal häufiger auf als bei Mädchen. Elterliche Persönlichkeitsstrukturen oder Erziehung als prädisponierende Faktoren sowie ein schichtspezifisches Auftreten der autistischen Störung werden heute nicht mehr diskutiert.
Eine Heilung ist nach heutigem wissenschaftlichem Kenntnisstand nicht zu erwarten. Eine Verbesserung der Symptomatik bei entsprechender Förderung und Vermittlung von Kompensationsstrategien jedoch möglich.
 facebook
facebook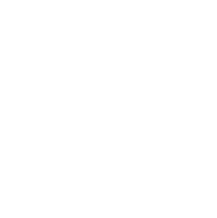 instagram
instagram LinkedIn
LinkedIn