An dem ursprünglichen Gesetzesentwurf hatte es von den Spitzenverbänden der Freien Wohlfahrtspflege und von einzelnen Verbänden der Behindertenhilfe massive Kritik gegeben. Auch der Regionalverband autismus Ostwestfalen-Lippe e.V. hatte Nachbesserungen gefordert. Die Koalitionspartner haben sich einvernehmlich dieser Kritik gestellt und den Gesetzesentwurf in 68 Punkten kurzfristig noch geändert.
Klaus Wollny, Geschäftsführung Regionalverband autismus Ostwestfalen-Lippe e.V., fasst in einer vorläufigen Einschätzung die zentralen Verbesserungen für Menschen mit einer Beeinträchtigung im künftigen BTGH zusammen. Anfang 2017 wird der Regionalverband autismus Ostwestfalen-Lippe e.V. dazu eine detaillierte Stellungnahme veröffentlichen:
Leistungsberechtigter Personenkreis (§ 99 SGB IX)
Eine Einschränkung des berechtigten Personenkreises ist nicht gewollt, eine Ausweitung soll jedoch auch vermieden werden. Auf die „5 aus 9“ oder „3 aus 9“ Regelung in § 99 SGB IX wird daher verzichtet. Stattdessen bleibt die geltende Gesetzeslage bestehen, bis zum 1. Januar 2023 ein durch den Gesetzgeber konkretisierter § 99 SGB IX in Kraft tritt. Die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege und einzelne Verbände der Behindertenhilfe haben sich massiv dafür eingesetzt, dass die neuen Zugangskriterien vor Inkrafttreten wissenschaftlich und in Modellen untersucht werden.
Selbstbestimmtes Leben/ Wunsch- und Wahlrecht
Die Sorgen vieler Betroffener, sie könnten zukünftig nicht mehr selbstbestimmt über die Form ihres Wohnens entscheiden, wurden ebenfalls weitgehend ernst genommen. Jeder soll im Rahmen der Angemessenheit und Zumutbarkeit entscheiden können, wie oder mit wem er lebt. Die Regelungen zur Beachtung der Besonderheiten des Einzelfalls sind demzufolge klarer gestaltet worden. Zusätzlich wird außerhalb stationärer Einrichtungen das Wunsch- und Wahlrecht der Leistungsberechtigten gestärkt. Entscheidend ist, dass den Wünschen der Betroffenen bei der gemeinsamen Inanspruchnahme von Assistenzleistungen besondere Bedeutung beigemessen wird. Gemeint sind solche Assistenzleistungen, die die unmittelbare Privatsphäre der Berechtigten betreffen. Ärgerlich bleibt, dass das "Zwangspoolen" - die gemeinsame Inanspruchnahme von Leistungen - nicht generell gestrichen wurde.
Beschäftigte in Werkstätten für Menschen mit Behinderung/ Anhebung Sparbetrag SGB XII
Durch zwei Änderungen für die 300.000 Beschäftigten in den Werkstätten für Menschen mit Behinderung wird künftig eine geringfügige Verbesserung eintreten: Das Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in Werkstätten wird auf 52 Euro verdoppelt. Zusätzlich wird der Sparbetrag für Menschen, die nicht erwerbsfähig sind und Leistungen der Grundsicherung beziehen, von derzeit 2.600 auf ca. 5.000 Euro angehoben. Von dieser Regelung werden alle Bezieher von Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII profitieren.
Arbeiten
Der Wechsel von Werkstätten für Menschen mit Behinderung in den ersten Arbeitsmarkt soll leichter werden. Arbeitgeber sollen bei der Einstellung von Menschen mit Behinderung bis zu 75 Prozent des Lohns erstattet bekommen. Mit diesem Budget für Arbeit soll die Zahl der rund 39.000 Unternehmen ohne Behinderte unter ihren Beschäftigten gesenkt werden. Wer einen höheren Studienabschluss macht, soll Assistenzleistungen bekommen.
Schnittstelle Eingliederungshilfe und Pflege
Die Schnittstelle zwischen der Eingliederungshilfe und der Pflege ist von den Verbänden und den Ländern besonders stark kritisiert worden. Hintergrund ist folgender: Mit dem Pflegestärkungsgesetz III wird der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff auch in der Hilfe zur Pflege eingeführt. Zwar nähern sich die Leistungen von Pflege und die Eingliederungshilfe an, werden aber nicht völlig identisch sein. Nach harten Auseinandersetzungen ist nun erreicht worden, dass das geltende Recht fortgesetzt wird. Das heißt, es wird keinen Vorrang der Pflege vor der Eingliederungshilfe geben! Auch die Ausweitung des Kostendeckels auf ambulante Wohngruppen wird nicht vollzogen.
Die Ideen des Bundesrates zum sogenannten „Lebenslagenmodell“ sind ebenso aufgegriffen worden: Menschen mit Behinderungen, die vor Erreichen der Regelaltersgrenze eine Behinderung erworben haben und Hilfe zur Pflege (Sozialhilfeleistung) beziehen, werden grundsätzlich der Eingliederungshilfe zugeordnet. Wer erstmalig nach Erreichen der Regelaltersgrenze eine Behinderung bekommt, wird den Leistungen der Pflegeversicherung (Versicherungsleistung) und ergänzend der Hilfe zur Pflege zugeordnet. Daneben sind Leistungen der Eingliederungshilfe weiterhin möglich. Die Politik sieht in diesem Modell keine Altersdiskriminierung. Denn, so argumentiert sie, die Lebenslagen von Menschen, die von Geburt an oder während ihres Erwerbslebens eine Behinderung erfahren, und denen, die erst im hohen Alter eine Behinderung bekommen, sind unterschiedlich. Die Regelaltersgrenze sei daher der richtige Weg, eine eindeutige Zuordnung vorzunehmen, welches Leistungsrecht wann den Vorrang hat.
Schwerbehindertenvertretung
Nach der heftigen Kritik der Schwerbehindertenvertreter in Unternehmen und der öffentlichen Verwaltung werden künftig die Anhörungsrechte gestärkt. Bei der personellen Einzelmaßnahme „Kündigung“ muss die Schwerbehindertenvertretung angehört werden: Verstößt der Arbeitgeber gegen dieses Recht und beteiligt sie nicht, ist die Kündigung unwirksam.
Teilhabeplan
Sozialamt, Reha-Träger, Bundesagentur, Sozialkassen - bisher muss ein Mensch mit Behinderung oft all diese Stellen abklappern und unzählige Formulare ausfüllen. Künftig soll ein einziger Antrag das gesamte Prüf- und Entscheidungsverfahren in Gang setzen. Die Betroffenen sollen besser beraten werden, die Ämter und Stellen sollen sich kurzschließen und einen Teilhabeplan erstellen. Es soll exakt ermittelt werden, was der Einzelne braucht.
Vermögen
Wer Eingliederungshilfe erhält, damit ist die Sozialhilfe für Menschen mit dauerhafter oder drohender Behinderung gemeint, soll nicht mehr nur 2.600 Euro seines Barvermögen behalten dürfen, ohne dass dieses angerechnet wird. Ab 2017 sollen es 27.600, ab 2020 dann 50.000 Euro sein. Auch das Partnereinkommen soll anrechnungsfrei bleiben. Zudem soll die Vorlage des Einkommensteuerbescheids als Beleg künftig ausreichen - heute müssen Betroffene ihre Einkommen und Ausgaben im Detail offen legen. Außerdem soll der Eigenanteil zur Eingliederungshilfe aus eigenen Einkünften sinken. Damit können rund 70.000 Berufstätige mehr von ihrem Einkommen behalten. Ein Beispiel: Von einem Bruttoeinkommen von 3.500 Euro werden heute bis zu 900 Euro abgezogen, in der Übergangsphase 600 Euro und ab 2020 noch 240 Euro.
Beratung
Es werden unabhängige Beratungsstellen aufgebaut und vom Bund bis 2022 mit bis zu 60 Millionen Euro gefördert.
Bildung
Bisher werden Assistenzleistungen für behinderte Studenten nur bis zum ersten Examen finanziert, künftig bis zum Masterabschluss und in Einzelfällen auch bis zur Dissertation.
Kosten
Länder und Kommunen geben pro Jahr rund 17 Milliarden Euro für die Eingliederungshilfe aus, Tendenz steigend. Die Reform führt nach Schätzungen des Bundesarbeitsministeriums zu zusätzlichen jährlichen Ausgaben von rund 700 Millionen Euro. Die Mehrausgaben trägt der Bund.
Evaluation
Es werden Vorkehrungen für einen stabilen Umsetzungsprozess des neuen Gesetzes getroffen, indem der Umfang der Evaluationen deutlich erhöht wird und in zentralen Bereichen modellhafte Erprobungen vorgesehen sind. Die Betroffenen sowie die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege und Verbände der Behindertenhilfe sollen in diesen Prozess einbezogen werden.
Weitere Informationen zum Bundesteilhabegesetz finden Sie auch auf den Webseiten des Bundesverbandes Autismus Deutschland e.V. und des Paritätischen NRW:
 facebook
facebook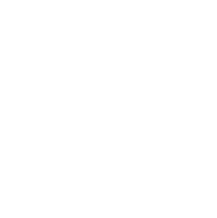 instagram
instagram LinkedIn
LinkedIn
